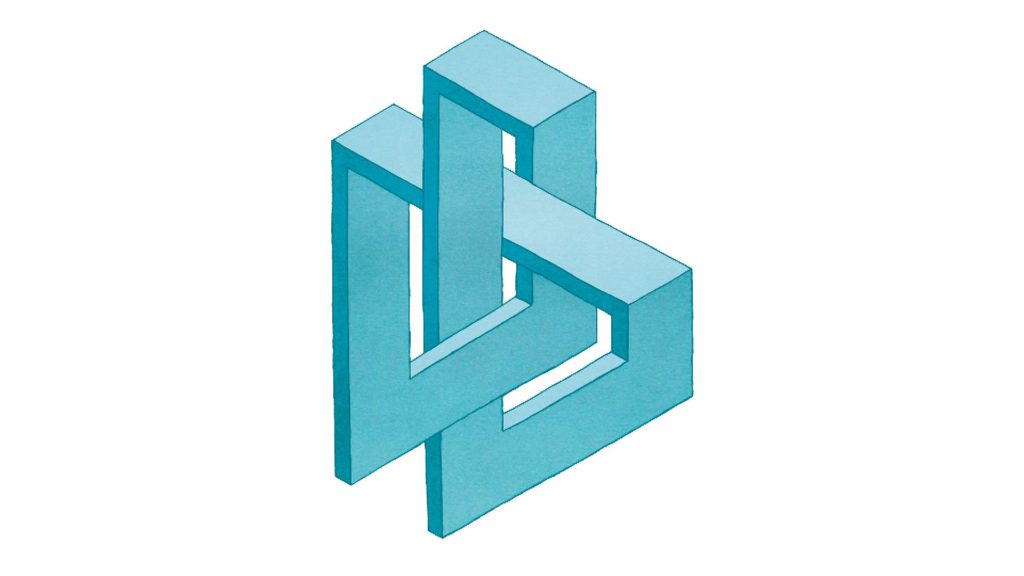Wenn über ein Buch gesprochen wird, das zu Beginn der 1990er Jahre erschienen ist, dann ist es notwendig, den damaligen Zeitkontext in Erinnerung zu rufen. Die Themen Nationalismus und Rassismus hatten in Deutschland zu der Zeit dramatisch an Bedeutung gewonnen. Spätestens, als in dem sächsischen Städtchen Hoyerswerda mehrere Nächte lang Wohnheime für DDR-Vertragsarbeiter und Geflüchtete attackiert wurden. Der Ort war einer der Ausgangspunkte für eine monatelang andauernde rassistische Gewaltwelle mit späteren „Höhepunkten“ in Rostock, Mölln und Solingen.
Das linke und linksliberale Milieu in der Bundesrepublik war vom theoretischen Rüstzeug her auf dieses Erstarken rassistischer Artikulationen nicht vorbereitet. Die bürgerliche Zivilgesellschaft protestierte gegen „die Gewalt“ mit sprachlosen „Lichterketten“, scheute aber davor zurück, diese Gewalt auch als rassistisch gerichtet zu benennen. Bis dahin war der Begriff Rassismus reserviert gewesen für die Zeit des Nationalsozialismus. So konnte Rassismus routinemäßig verurteilt werden, ohne sich mit aktuellen Ausprägungen zu befassen. In Bezug auf die Bundesrepublik wurde ab den 1970er Jahren von „Ausländerfeindlichkeit“, später von „Fremdenfeindlichkeit“ gesprochen. Diese Konzepte zogen aber niemals in Zweifel, dass „Ausländer“ oder „Fremde“ real existieren. So hatten etwa linke Aktivist*innen mit „den Italienern“ für den Sozialismus und mit „den Griechen“ gegen die Diktatur gekämpft. Oder man hatte „die Türken“ oder Geflüchtete gegen Vorurteile in Schutz genommen. Doch von Rassismus zu sprechen im Hinblick auf Vorgänge in der Bundesrepublik war ein No-Go geblieben.
Ende der 1980er Jahre hatte es zumindest in kleinen Kreisen eine Beschäftigung mit Rassismus gegeben. In Tübingen organisierten Studierende eine Vortragsreihe explizit zum Thema. Der Erziehungswissenschaftler Rudolf Leiprecht verwendete 1990 den Begriff in einer empirischen Studie. Es fanden Kongresse statt, Vereine wurden gegründet, einige Bücher zum Thema erschienen. In einem recht kurzen Zeitraum auch eine ganze Reihe von Übersetzungen – von Stuart Hall, George L. Mosse, Léon Poliakov, Ernest Gellner, Colette Guillaumin und eben Balibar/Wallerstein. Diese Werke wurden zur Kenntnis genommen, doch es wurde auch klar, wie schwer man sich in Deutschland mit der neuen Begrifflichkeit tat.
Erstaunlich war vor allem die Resistenz, mit der trotz komplett gegenläufiger Analysen am Konzept der „Rasse“ festgehalten wurde. In seiner Geschichte des Rassismus (1988) wies etwa der Historiker Immanuel Geiss nach, dass die Bedeutung des Unterscheidungsmerkmals Hautfarbe letztlich das Ergebnis einer Praxis von Besitznahme, erzwungener Arbeitsteilung und Gewaltherrschaft war. Dennoch bestand er darauf, dass die „Aufteilung der Menschheit in Groß-Gruppen nach äußeren Merkmalen von Bernier bis Kant“ zu Beginn „durchaus sinnvoll“ gewesen sei, und stellte fest: „Die größten Groß-Gruppen lassen sich als Europiden, Mongoliden und Negriden unterscheiden.“ (S. 15) Ähnliches war von ausgesprochenen Vertretern der deutschen Linken zu hören. Auf dem vollbesetzten Kongress der Zeitschrift Konkret sorgte 1993 ein Beitrag des Philosophen Christoph Türcke für regelrechte Tumulte. In seinem Referat und auch später im schriftlichen Beitrag hatte er die Existenz von „Menschenrassen“ verteidigt. Dass es „Menschengruppen schwarzer, weißer, gelber oder rötlicher Hautfarbe“ gebe, sei keine „Erfindung ressentimentgeladener Mitteleuropäer“, sondern „simple Tatsache“ (Christoph Türcke, „Die Inflation des Rassismus“, in: Konkret, Nr. 8, 1993, S. 35–41).
Schaut man von heute aus auf die Debatten zurück, so erscheint es ebenfalls erstaunlich, mit welcher Vehemenz in vielen Beiträgen zum Thema Rassismus zugleich der Antirassismus zurückgewiesen wurde. Das erinnert an den Furor, mit dem viele Feuilletonist*innen wenig später gegen die „political correctness“ polemisierten. Der Philosoph und Historiker Fabian Kettner schreibt: „Nirgends wird man grundsätzlicher, differenzierter und feinsinniger, wenn es darum geht, Rassisten vor ihrer Benennung als solche zu bewahren.“ Tatsächlich gab es die Tendenz, einen „Rassismus von oben“ zu verurteilen, während die „Massen“, das potenzielle revolutionäre Subjekt, nur als fehlgeleitet betrachtet wurden: Der Rassismus sei, meinte der Philosoph Wolfgang Fritz Haug, „entfremdeter Protest“ (Wolfgang Fritz Haug, „Zur Dialektik des Antirassismus. Erkundungen auf einem Feld voller Fallstricke“, in: Das Argument. Nr. 191, 34. Jahrgang 1992. S. 27-52, hier S. 33). Solche Auffassungen gerieten zunehmend mit jenen in Konflikt, die ihre politische Stoßrichtung explizit als antirassistisch verstanden – etwa den Aktivist*innen des Netzwerks Kanak Attak. Tatsächlich kam die deutsche Diskussion – die öffentliche wie auch die linke – weitgehend ohne Berücksichtigung der Subjektivität der Eingewanderten aus. Ob es um die Rettung von „Deutschlands Ansehen“ in der Welt ging oder um die Rettung des „revolutionären Subjektes“, die Debatten verblieben in einem Raum des einheimischen „Unter-sich“. Für Personen mit Migrationshintergrund verbot sich jede sympathisierende Betrachtung der „Massen“, denn deren „entfremdeter Protest“ konnte gefährliche Folgen für das eigene Leben haben.
Nun war der Aspekt von Rasse, Klasse, Nation, der bei weitem die meiste Aufmerksamkeit erhielt, Étienne Balibars Definition des „Neorassismus“ als eines „Rassismus ohne Rassen“ und „Meta-Rassismus“. Doch der deutsche Kontext war ein ganz anderer als jener, in dem Balibars Aufsätze entstanden waren. Balibar hatte darauf hingewiesen, dass die Neufassung der rassistischen Diskurse sich den konkreten Widerstandsformen verdankte, die bestimmte Artikulationen immer mehr als illegitim erschienen ließen, vor allem die Rede von biologischen „Rassen“. Das war die historische Bewegung der Entkolonisierung auf der einen Seite und auf der anderen die massiven antirassistischen Proteste der Eingewanderten, die ab den frühen 1980er Jahren in Frankreich stattfanden. Die Bundesrepublik dagegen betrachtete sich selbst als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches und schon seit 1919 als quasi „postkolonial“. Darüber hinaus hielt die BRD bis zum Jahr 2000 am Konzept der ethnischen Homogenität fest. Die Einwanderung galt als vorübergehend, was auch bedeutete, dass sich die politischen Betätigungen der Migrant*innen weitgehend auf deren Herkunftsländer bezogen.
Die antifaschistischen und antirassistischen Aktivist*innen der frühen 1990er Jahre waren daher nicht nur mit dem Kampf gegen die rechte Gewalt beschäftigt, sondern auch mit der Bekämpfung einer neuen „Mitte“, die sich durch eine meta-rassistische Erklärung der Gewalt und durch kulturelle Abgrenzung (etwa von „fanatisierten“ Religionen wie „dem Islam“) gerade in ihrem neorassistischen Konsens als besonders aufgeklärt deklarierte. Eine hohe Aufmerksamkeit erfuhr Rasse, Klasse, Nation vielleicht deshalb auch bei den Aktivist*innen von Kanak Attak, eines Netzwerkes das jahrelang in Aktionen, Revuen, Veranstaltungen und Medienarbeit („Kanak TV“) versucht hat, die theoretische Arbeit über Rassismus mit praktischen Interventionen zu verbinden. Kanak Attak attackierte nicht nur die Konservativen, sondern auch die vielen „Gutmeinenden“, die – ausgestattet mit multikulturalistischer Ethik – jede Person mit Migrationshintergrund als Vertreter*in einer ethnischen Kultur betrachteten und die, anstatt die Normalität der Einwanderungsgesellschaft anzuerkennen, unentwegt die „Bereicherung“ durch das „Fremde“ zelebrierten. Gleichzeitig war schon zu diesem Zeitpunkt klar, dass die „offene Gesellschaft“ in der „Mitte“ weiterhin scharfe Grenzen zog, indem sie Fanatismus, Gewalt, Antisemitismus, Sexismus und Homophobie auf „die Anderen“ projizierte.
Heute wird weiterhin auf Balibars These zum „Neorassismus“ Bezug genommen, was durchaus erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass sein Text über ein „Neo“-Phänomen nun auch bereits 30 Jahre alt ist. In der neueren Rassismuskritik, den „postkolonialen“ und „Critical Whiteness“-Ansätzen spielen Balibars und Wallersteins Gedanken aber praktisch keine Rolle mehr. Das hat natürlich auch mit einer generellen Verschiebung der Wahrnehmung zu tun, in der die Subjektivität der Betroffenen dominiert und die gesellschaftspolitische Frage kaum eine Rolle spielt. Wenn in den Colleges der Vereinigten Staaten von Amerika in Anlehnung an den Psychologen Derald Wing Sue das Konzept der „microaggression“ vorherrscht, dann geht es in erster Linie um Beleidigungen, Verletzungen und deren Wirkung auf Individuen. Die strukturelle Seite wird dabei aufgerufen über die Herstellung einer nichtverletzenden, gewissermaßen „gesunden“ Atmosphäre.
Nun geht es nicht darum, die subjektive und die strukturelle Perspektive gegeneinander auszuspielen – das wäre sicher nicht im Sinne von Balibar und Wallerstein. Doch in vielerlei Hinsicht kommt die institutionelle Perspektive heute zu kurz. Obwohl es an den Universitäten bereits an einigen Orten rassismuskritische Positionen gibt, fehlt es weiter an der Kontinuität der Forschung – ein Lehrstuhl für Rassismusforschung ist nicht in Sicht. Die im engeren Sinne politischen Fragen des „ethnisierten“ Arbeitsmarktes, der Staatsbürgerschaft als Mitgliedschaftsregelung im Nationalstaat oder die strukturellen Formen der Bevorzugung von bestimmten Herkunftsgruppen im Nationalstaat sind in der antirassistischen Diskussion unterrepräsentiert. Die Verwobenheit von Klassenzugehörigkeit und Rassismus kann aber nicht ignoriert werden, wenn in einer demokratischen Gesellschaft wie Deutschland die Personen mit Migrationshintergrund ein durchschnittliches Armutsrisiko haben, das mehr als doppelt so hoch ist wie das der Bevölkerung deutscher Herkunft.