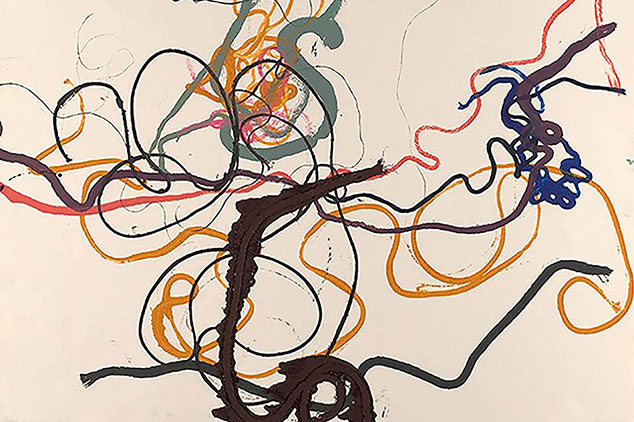Radiokunst ist als eigene Sparte bislang noch nicht so bekannt wie andere Kunstrichtungen. Wie ist sie entstanden, und was genau zeichnet sie aus?
Nathalie Singer: Zunächst mal gibt es eine klare Unterscheidung zwischen Radiobetrieb und Radiokunst. Im Radiobetrieb geht es in erster Linie um Informationsvermittlung oder Musik. In der Radiokunst, um die es in der Ausstellung geht, stehen künstlerische Perspektiven aufs Medium im Zentrum. Da geht es beispielsweise um die Frage, wie Künstler*innen es benutzen und aus den technischen Gegebenheiten des Radios eine eigene Sprache entwickeln. Denn das Radio hat ja eine ganz eigene Sprache. Es stimmt zwar, dass Radiokünstler*innen sich anfangs stark auf andere Künste bezogen haben, auf Theater, Literatur, Oper, auch auf Techniken aus der bildenden Kunst, dem experimentellen Film. Aber in ihrer Kunst haben sie an einer akustischen Umsetzung gearbeitet, die mit keiner anderen Sparte vergleichbar ist.
Können Sie ein paar Beispiele nennen?
Nathalie Singer: Das klassischste Beispiel ist natürlich das Hörspiel, das ganz am Beginn der Auseinandersetzung mit dem Medium stand. Mittlerweile schöpft die Radiokunst aber auch aus einem viel breiteren künstlerischen Spektrum. Da gibt es Einflüsse aus Performance, Medienkunst, immersiven Medien. Unter anderem sind dadurch Klanginstallationen entstanden, wie Max Neuhaus’ Drive In Music. Werke wurden in den elektroakustischen Studios der Rundfunkanstalten entwickelt, in denen Klang und Sound auf neue Art und Weise verhandelt wurden. Und heute beeinflusst unser Umgang mit Handys und GPS-Systemen die Radiokunst: Performative Walks, bei denen das Publikum per Radioanweisung durch die Stadt geführt wird, werden immer beliebter.
Jacob Eriksen: Oft geht es in dieser Sparte um das Spiel mit so genannten Sendekonstellationen. Denn ursprünglich war das Besondere am Radio ja mal, dass Sender und Empfänger sich in unterschiedlichen Räumen aufhielten und eine große Anzahl von Menschen eine Sendung zur exakt gleichen Zeit hörte.
Herr Eriksen, Sie haben mit Student*innen an Klanginstallationen gearbeitet, die diese Sendekonstellationen neu interpretieren. Was ist dabei entstanden?
Jacob Eriksen: Eine der Arbeiten hat sich an Neuhaus’ Drive In orientiert. Dabei sind Radio gesteuerte Spielzeugautos mit installierten Lautsprechern rausgekommen, die durch den Radiophonic Space im HKW fahren werden. Wie bei Neuhaus geht es den Student*innen darum, mit dem Auto durch eine „Landschaft“ zu fahren und die Klänge aus der Umgebung per Radio übermittelt zu bekommen. Um das Phänomen, das wir aus dem Auto kennen, wenn wir über lange Strecken fahren und Sender sich über bestimmte Regionen oder Landesgrenzen hinweg – auch in Tunneln oder Gebirgen – ändern, überlagern oder verschwinden. Im HKW wird das Gleiche nun auf ganz engem Raum passieren.
Nathalie Singer: Das ist spannend, weil die Radiokunst tatsächlich immer auch an den Störungen, am Rauschen und am Dazwischen im Sendeprozess interessiert ist. Am Phänomen der Hörbarwerdung oder der Hörbarmachung einer Übertragung. Unsere Ausstellung ist vom akustischen Raum her so aufgebaut, dass man genau das erleben kann: dass man die Störgeräusche mit im Ohr hat, sobald man sich neuen Sendern nähert, die im Raum verteilt sind. Weil man sich zwischen den Frequenzen bewegt. So können die Zuschauer sich wie menschliche Sendersuchnadeln durchs HKW bewegen.
Sie arbeiten bei dieser Ausstellung viel mit digitaler Technik. In wieweit hat das Radio sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten dadurch gewandelt?
Jakob Eriksen: Radio ist seit einer Weile digital erfahrbar, über Apps, Podcasts und Ähnliches. Und das verschiebt natürlich Hörerlebnisse, vor allem die Auswahlmöglichkeiten. Hörer sind heute nicht mehr abhängig von einem einzigen Sendemast. Sie brauchen bestenfalls Internetzugang, und das ermöglicht radiotechnisch neue Möglichkeiten. Heute ist es für jeden Teenager ein Leichtes, einen eigenen Radiosender zu basteln. Auf einmal gibt es wunderbare Community-Projekte wie Cashmere Radio, die von unterschiedlichen Orten in Berlin senden. Es gibt da diesen neuen Amateurismus im Radio, durch den viel Innovatives entsteht.
Entstehen für Wissenschaftler*innen und Künstler*innen auch neue Möglichkeiten durch die zeitliche Unabhängigkeit im Digitalen?
Nathalie Singer: Ja, das ist tatsächlich etwas Revolutionäres, diese absolute Veränderung der Zeitlichkeit. Man muss nicht mehr in Realzeit hören und kann selbst entscheiden, wo man welchem Inhalt lauscht. Webseiten werden auf einmal durch digitale Angebote von Archiven und Sammlungen interessant. Und auf einmal gibt es eine neue Haltbarkeit, das typische Versendungsmerkmal des Radios löst sich auf. Sender gehen ein und doch existieren ihre Inhalte weiter im Netz. Es gibt Friedhöfe voller un-toter Sendungen. Das ist ein enormes Material, aus dem Künstler*innen und Wissenschaftler*innen schöpfen können. Andererseits verschwindet durchs Digitale der Reiz des moderierten, konzentrierten Programms. Auch die Hörercommunity, die sich auf einzelne Sender bezog und sich ihnen zugehörig fühlte. Vermutlich gehen die Leute fürs gemeinschaftliche Radioerlebnis deshalb nun häufig in den öffentlichen Raum, wie beim Leipziger Hörspielsommer.
Wie kuratiert man ein Projekt wie Radiophonic Spaces bei all der Auswahl, den zeitlichen und künstlerischen Strömungen?
Nathalie Singer: Das war natürlich nicht leicht. Wir wollten auf keinen Fall etwas mit Kanon-Charakter kreieren, aber es sollte nach Möglichkeit auch nichts Wichtiges ausgelassen werden. Glücklicherweise kamen die Kurator*innen aus sehr unterschiedlichen Bereichen und kannten sich in ganz verschiedene Aspekten der Radiokunst aus. So ist am Ende eine Teilnehmer*innen-Liste zustande gekommen, in der Arbeiten von John Cage neben denen von Student*innen der Bauhaus Universität stehen.
Jacob Eriksen: Mir war es wichtig, diese neue Generation von Klangkünstler*innen vorzustellen. Auch die Verbindung zwischen ihren Ansätzen und dem Verständnis für die klassischen Traditionen der Radiokunst rauszuarbeiten. Schon weil die Künstler*innen der Podcast-Generation nicht gerade großzügig gefördert werden und man aufpassen muss, dass ihre Kunst nicht eines Tages ausstirbt.
Wie denkt diese neue Generation die Radiokunst denn bislang weiter?
Nathalie Singer: Unter deutlich veränderten Vorzeichen. Bei uns lief zu Hause früher oft französisches Radio, da meine Mutter aus Frankreich stammt. Für mich hat sich dadurch eine zweite Welt aufgetan, eine andere Identität, zu der ich vor allem durchs Radio Zugriff hatte. In Zeiten des digitalen Sendens gibt es heute noch ganz andere Möglichkeiten des Austauschs. Vor allem für Radiokünstler*innen, wenn sie vor dem Hintergrund dieser Möglichkeiten die vergrabenen Schätze aus den Archiven ans Licht bringen. Schätze, die andernfalls gelöscht werden oder einfach kaputt gehen.
Jacob Eriksen: Das sehe ich ganz ähnlich. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Dänemark, in dem es kaum Radiosender gab. Bei gutem Wetter und mit etwas Glück konnte ich früher deutsches und schwedisches Radio hören. Das waren faszinierende Streifzüge in fremde Welten. Für Radiophonic Spaces setzen sich manche meiner Studierenden jetzt mit einem Samuel Beckett-Text auseinander. Und für sie ist völlig selbstverständlich, dass sie das in mehreren Sprachen tun. Ihr Hörspiel wird in verschiedenen Sprachen live auf der Bühne im HKW-Ausstellungsraum übertragen. Man kann sie alle nebeneinander hören oder sich per Kopfhörer für eine entscheiden. Für mich symbolisiert das auf sehr schöne Art und Weise die neuen Möglichkeiten der Radiokunst. Quasi eine analoge Art, sich den neuen digitalen Technologien zu widmen.