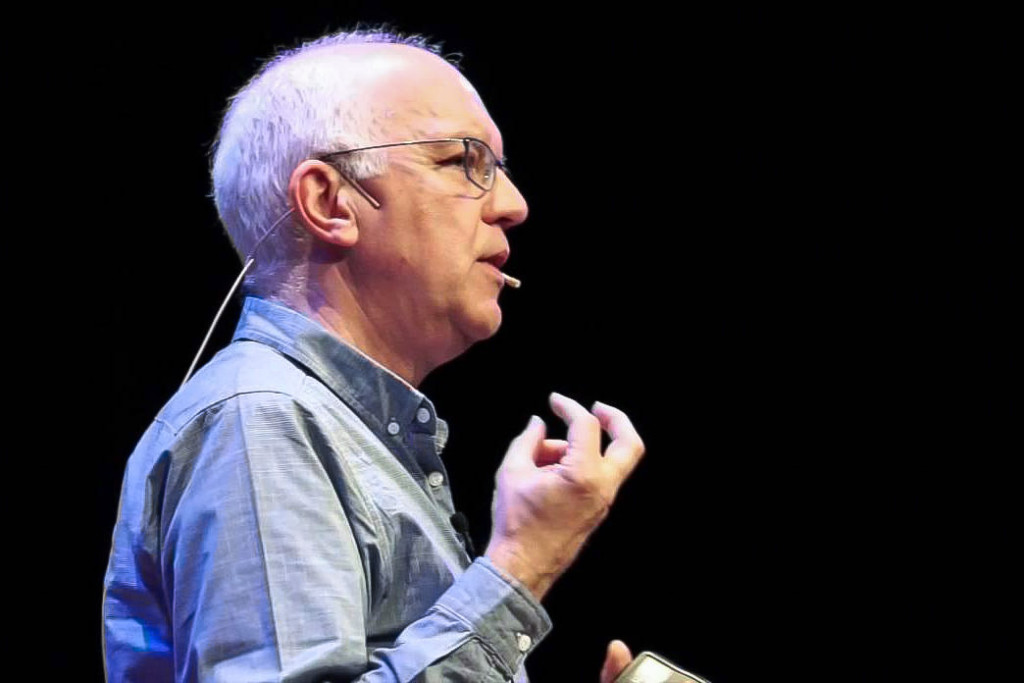I enjoy surprising my students by telling them that I am a conservative,
that I have striven throughout my life to ‘conserve our radical tradition.’
George Counts, 1971
Lehren ist wichtig. An sich ist das keine sonderlich kontroverse Behauptung, in bestimmten Kreisen wird spricht man von Lehrer*innen sogar als wichtigstem „Faktor“ in der Bildungsarbeit. Doch wir sollten davor hüten, Lehrer*innen lediglich als Faktoren zu bezeichnen. Die entscheidende Frage lautet schließlich nicht, ob das Lehren wichtig ist, sondern inwiefern und wozu es wichtig ist. Diese Frage macht die Diskussion bereits ein wenig komplexer, denn seit ein paar Jahren werden Rolle und Stellenwert von Lehre und Lehrkräften aus zwei verschiedenen, einander jedoch in gewisser Weise ergänzenden Blickwinkeln infrage gestellt.
Neue „Lern-Sprachen“ und eine neue Lern-„Logik“ haben sich in diesem Zusammenhang auf die pädagogische Praxis ausgewirkt, weil die Aufmerksamkeit von Lehren und Lehrer*innen hin zu Schüler*innen und deren Lernverhalten verlagert wurde. Infolgedessen sind Lehrer*innen von allwissenden Wissensvermittler*innen („sage on the stage“) zu Lernbegleiter*innen („guide at the side“) geworden, wenn nicht sogar, wie manche meinen, zu Gleichrangigen im Hintergrund („peer at the rear“). Doch auch wenn die Vorstellung von Lehrer*innen als Mitlernenden und vom Klassenzimmer als Lerngemeinschaft attraktiv und fortschrittlich wirken mag, vermitteln diese lernzentrierten Darstellungen von Bildungsarbeit noch immer keinen hilfreichen – meiner Ansicht nach sogar eher irreführenden – Eindruck vom Lehren. Auch von der Arbeit an Schulen vom Nutzen, den Schüler*innen aus der Begegnung mit Lehren und Lehrenden ziehen können. Mit meinen Überlegungen möchte ich daher das Lehren im Zeitalter des Lernens neu beleben und die Bedeutung und Wichtigkeit von Lehre und Lehrkräften wiederentdecken.
Für die Bedeutung von Lehre und Lehrer*innen einzutreten, ist allerdings nicht ganz unproblematisch. Eine große Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass die Wichtigkeit des Lehrens in den letzten Jahren vor allem von konservativer Seite laut propagiert wurde – von Gruppen, die es im Wesentlichen mit Kontrolle verbinden und die Kontrolle der Lehrtätigkeit zu einem wichtigen Thema gemacht haben. Begründet wird dies unter anderem damit, dass die besten und effizientesten Lehrer*innen diejenigen seien, die das zuverlässige Erreichen einiger weniger festgelegter „Lernziele“ sicher stellten und dabei lediglich eine begrenzte Anzahl an vorgegebenen Identitäten zuließen, wie etwa gute Bürger*innen oder flexible, lebenslange Lerner*innen. Hinsichtlich dieser Ziele wird nicht nur laufend nach Beweisen dafür geforscht, was „funktioniert“, sondern es existiert auch eine „globale, bildungsspezifische Vermessungsindustrie“ (Gert Biesta), die darauf bedacht ist, die leistungsfähigsten Systeme für die gewünschten Ergebnisse herauszustellen. Die Forderung nach kontrollierender Bildungsarbeit und Lehrkräften als Kontrollpersonen äußert sich auch in der Sorge über einen offensichtlichen Autoritätsverlust in der Gegenwartsgesellschaft und der Behauptung, Bildungsarbeit sei der Schlüssel zur Wiederherstellung dieser Autorität, einschließlich der von Lehrenden selbst. In diesen Diskussionen wird allerdings bequemerweise oft vergessen, dass Autorität im Wesentlichen eine Frage von Beziehungen ist, und nicht etwas, das man anderen einfach aufnötigen kann.
Das Konzept und die Darstellung vom Lehren als Akt der Kontrolle sind insofern problematisch, als Schüler*innen in solchen Konfigurationen nur als Objekte der Absichten und Handlungen von Lehrer*innen erscheinen können, jedoch nicht als eigenständige Subjekte. Dies war der Hauptvorwurf aller bisherigen Kritiken an autoritären Bildungsformen, die in der Forderung gipfelten, das „Projekt“ Erziehung und Bildung gleich als Ganzes abzuschaffen, wie beispielsweise in der Antipädagogik, die in den späten 1960er-Jahren in Deutschland entstand. Es ist interessant und in gewisser Weise bemerkenswert, dass Lehrende immer wieder zur Zielscheibe dieser Kritik werden. Dies scheint der Annahme geschuldet, dass das Lehren letztlich nur als etwas verstanden werden kann, das die Freiheit von Schüler*innen einschränkt und ihnen die Möglichkeit nimmt, als eigenständige Subjekte zu existieren. Nicht zuletzt deshalb gelten jene Ansätze als befreiend und fortschrittlich, die versuchen, Lehrende (buchstäblich) zu entthronen und in den Hintergrund treten zu lassen („vom allwissenden Wissensvermittler zum Lernbegleiter“). Ansätze, die den Bildungsprozess wieder auf die Schüler*innen, auf ihr Lernen, ihre Bedeutungsgebung und ihre aktive Wissensbildung ausrichten wollen ‒ um nur einige der wichtigsten Trends in der gegenwärtigen Theorie und Praxis der Bildungsarbeit zu nennen.
In diesem Kontext scheint jeder Versuch, für die Wichtigkeit des Lehrens und der Lehrenden einzutreten, nur als Rückschritt wahrnehmbar, als konservativer und nicht fortschrittlicher Beitrag zur Diskussion. Wichtig ist aber, dass dies nur dann der Fall ist, wenn wir unsere Vorstellung von der Existenz als Subjekt daran orientieren, was Hanna Arendt treffend mit dem Begriff der Freiheit als Souveränität bezeichnet hat. Frei zu sein, als freies Subjekt zu existieren, bedeutet demnach, nicht von etwas oder jemandem außerhalb von sich selbst beeinflusst zu werden. Die Frage ist jedoch, ob dies eine tragbare Vorstellung von der Existenz als Subjekt ist. Ich möchte dies bezweifeln und unter anderem anführen, dass die Existenz als Subjekt eigentlich bedeutet, sich mit dem Anderen in einem fortwährenden „Zustand des Dialogs“ zu befinden. Ein „Zustand des Dialogs“, in dem sich unsere Subjektheit nicht von innen herausbildet, also, aus unseren Absichten und Sehnsüchten, sondern eng mit der Art und Weise verwoben ist, wie wir mit dem Anderen umgehen, das uns anspricht, uns adressiert, uns anruft und dadurch etwas in uns hervorbringt.
Wenn wir vor diesem Hintergrund über unsere Existenz als Subjekt nachdenken, gewinnt das Lehren eine neue Bedeutung. Vor allem, weil es eine von außen kommende „Ansprache“ ist, die uns transzendieren kann und die unsere Möglichkeit, als Subjekt zu existieren, nicht mehr automatisch einschränkt oder behindert, sondern vielleicht genau das „Ereignis“ ist, das es uns erlaubt, als Subjekt zu existieren. Nun zu meinem anderen Argument. Ich habe es bereits eingehend dargestellt (2007), komme aber im Folgenden darauf zurück, um das Lehren in seiner Bedeutung für die Subjektheit, für unsere Existenz als Subjekte zu diskutieren. Hier erfüllt die Lehre den Zweck, Schüler*innen existenzielle Möglichkeiten zu eröffnen, durch die sie entdecken könnten, was es bedeutet, als Subjekt in und mit der Welt zu existieren. In diesem Kontext erscheint Lehren als das genaue Gegenteil von Kontrolle und allen Ansätzen, die Schüler*innen lediglich als Objekte ansprechen wollen. Vielmehr adressiert es Schüler*innen als Subjekte, auch wenn es keine Beweise dafür gibt, dass sie dazu fähig sind damit umzugehen.
Ich glaube, dass die hier vorgestellten Überlegungen aus drei Gründen von Bedeutung sein könnten. Der erste basiert auf der Tatsache, dass das Lehren in der Bildungsarbeit inzwischen gemeinhin am konservativen Ende des Spektrums verortet wird, während fast alles, was sich dagegen richtet ‒ etwa der Fokus auf das Lernen von Schüler*innen, auf ihre Bedeutungsgebung und Wissensbildung, ihre Kreativität und ihren Ausdruck ‒, als befreiend, fortschrittlich und förderlich für die Entwicklung von Subjektheit betrachtet werden. Das äußert sich zum Beispiel im derzeitigen „Schwenk“ von lehrplanzentrierten zu kind- und schülerzentrierten Bildungskonzepten. Was in dieser Diskussion erstaunlicherweise fehlt, ist eine dritte Option, in der die Lehre am fortschrittlichen Ende des Spektrums verortet ist und (wieder) mit emanzipatorischen Bildungszielen verbunden wird. Mit diesem Beitrag hoffe ich, eine solche dritte Option anbieten zu können: eine Reihe fortschrittlicher Argumente zugunsten einer heute allgemein als konservativ betrachteten Idee. Ich möchte nicht nur die fortschrittliche Bedeutung des Lehrens wiederentdecken, sondern auch zeigen, dass eine Ausrichtung auf das Schüler*innen-Lernen, auf Bedeutungsgebung, Wissensbildung, Kreativität und Ausdruck ‒ Konzepte, die oft als Methoden gegen Erziehung und Bildung als Kontrolle dargestellt werden ‒ an sich vielleicht nur wenig damit zu hat, Schüler*innen mehr Möglichkeiten zu geben, als Subjekte zu existieren.
Die Existenz als Subjekt bedeutet, sich in einem „Zustand des Dialogs“ mit dem Anderen zu befinden. Sie bedeutet, dem Anderen ausgesetzt zu sein, vom Anderen angesprochen zu werden, vom Anderen unterrichtet zu werden und darüber nachzudenken, was das für die eigene Existenz bedeutet und für die Sehnsüchte, die wir in Bezug auf die eigene Existenz haben. In der Existenz als Subjekt müssen wir uns fragen, ob unsere Wünsche nicht nur für unser eigenes Leben wünschenswert sind, sondern auch für unser Zusammenleben mit anderen – auf einem Planeten, der nur über begrenzte Kapazitäten verfügt, all die auf ihn projizierten Wünsche zu erfüllen. Die Existenz als Subjekt auf diese Art zu begreifen, steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem vielleicht wichtigsten Grundsatz unserer Zeit, in dem unsere Freiheit als menschliche Subjekte vor allem als Wahlfreiheit verstanden wird: als die Freiheit, das zu wählen, was wir wählen wollen, zu tun, was wir tun wollen, zu besitzen, was wir besitzen wollen, zu sein, was wir sein wollen, und zu kaufen, was wir kaufen wollen. Meine Auseinandersetzung mit der menschlichen Subjektheit wirft somit auch umfassendere Fragen über diesen wichtigen Trend in der heutigen Gesellschaft auf, die der Ökonom Paul Roberts meiner Ansicht nach sehr treffend als „Impuls-Gesellschaft“ bezeichnet hat.
Der dritte Grund, weshalb die hier vorgestellten Ideen von Bedeutung sein könnten, steht im Zusammenhang mit einer eher philosophischen Diskussion über das Menschsein und den Menschen. Obwohl meine Ziele nicht philosophischer, sondern pädagogischer Natur sind, könnte es interessant sein, über einen wichtigen philosophischen Aspekt meiner Überlegungen nachzudenken. Darüber, dass unsere menschliche Subjektheit womöglich nicht in unserem Lernvermögen verortet ist, in unserer Fähigkeit, Sinn zu stiften und Bedeutung zu verleihen, sondern vor allem in unserer Fähigkeit, angesprochen und unterrichtet zu werden. Das bedeutet schlicht und einfach, dass der Mensch zwar ein Lebewesen ist, das lernen kann, aber vor allem eines, das unterrichtet werden und (eine) Lehre annehmen kann.